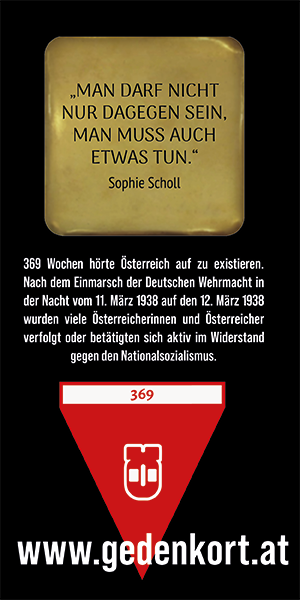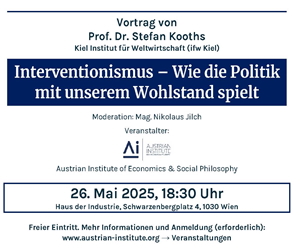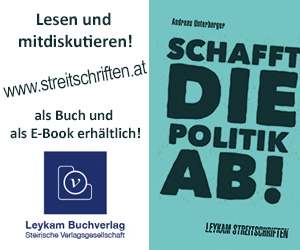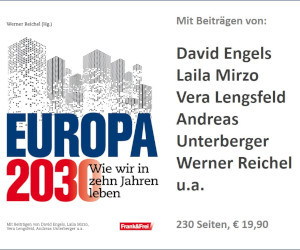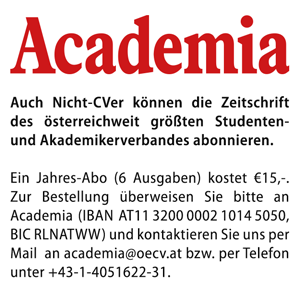06. November 2020 07:30 | Autor: Andreas Tögel
Vielen Unternehmern, besonders solchen, die im Gastgewerbe und in der Hotellerie tätig sind, geht es derzeit wie gesetzestreuen Waffenbesitzern seit vielen Jahren: Sie können noch so brav jedem Bocksprung der Behörden folgen, jede Menge Kosten und Mühen auf sich nehmen (z. B. für die immer strenger regulierte Registrierung und Verwahrung ihres Eigentums) – am Ende sind sie aber doch die Dummen. Eine neue Richtlinie aus Brüssel, ein dadurch motivierter Federstrich des Ministers – und sie sind entrechtet und enteignet.
weiterlesen
04. November 2020 11:02 | Autor: Florian Unterberger
Für Sebastian Kurz öffnet sich bis Weihnachten ein Window of Opportunity. Auf die Islamische Glaubensgemeinschaft sollte man hingegen eher nicht setzen.
weiterlesen
04. November 2020 07:45 | Autor: Alfons Adam
Unsere Bundesregierung hat am 3. September dem Nationalrat zwei Gesetzesentwürfe vorgelegt, und zwar den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem straf- und medienrechtliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden, und eines weiteren Bundesgesetzes über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen. Auf den Entwurf dieses Bundesgesetzes zum angeblichen Schutz der Nutzer will ich hier nicht eingehen. Es sei nur so viel gesagt, dass es im Zusammenhang mit den angeblichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz zu sehen ist.
weiterlesen
03. November 2020 13:35 | Autor: Viktor Orban
Der Anlass dieser Rede des ungarischen Ministerpräsidenten ist an sich unbedeutend (Eröffnung eines christlichen Gemeindehauses). Aber inhaltlich ist sie ein für westeuropäische Ohren ganz erstaunliches Bekenntnis zum Christentum, und vor allem zu seiner zentralen Rolle für die Prägung, die Kultur, die Identität eines Volkes. In der Folge im kompletten Wortlaut:
weiterlesen
02. November 2020 07:30 | Autor: Harald Helml
In Österreich werden wir seit rund sieben Monaten mit Corona sowie den sogenannten Corona-Maßnahmen konfrontiert, letzteren stehen die Bürger recht ohnmächtig gegenüber. Manche Menschen mögen nach einer gewissen Zeit über sich selbst sagen, niemand könne sie daran hindern, klüger zu werden, allerdings gilt dies nicht für die aktuellen Politiker der meisten Länder der Europäischen Union. Auch hierzulande haben die Politiker nichts dazugelernt.
weiterlesen
30. Oktober 2020 09:19 | Autor: Georg Vetter
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen den früheren Spionageabwehrchef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung erhoben. Es wird ihm vorgeworfen, für eine rechtswidrige Observation der nordkoreanischen Botschaft überhöhte Kaffeerechnungen in der Höhe von 1.100 Euro und zwei illegale Datenabfragen verantwortlich zu sein. Mit den seinerzeitigen Hausdurchsuchungen beim BVT soll dies nichts zu tun haben.
weiterlesen
28. Oktober 2020 07:15 | Autor: Leo Dorner
Der türkische Präsident Erdogan ist vielbeschäftigt. Ironisch könnte man sagen, der Weltgeist habe ihm mehrere Großaufträge ins Haus geschickt: Warum nicht soll eine neoosmanische Türkei oder etwas Vergleichbares in naher und ferner Zukunft möglich sein? An welche Analogie wäre zu denken? An eine ideologische Führerrolle beispielsweise in der Agenda des Dschihad in Europa? Nicht die Mullahs zu Teheran, auch nicht die vielen Prinzen auf der saudiarabischen Halbinsel wären dazu berufen, sondern allein und einzig der oberste Muslimbruder zu Ankara?
weiterlesen
23. Oktober 2020 14:04 | Autor: Andreas Tögel
Schon anno 2016 wäre die Präsidentschaftswahl eindeutig zugunsten die US-Demokraten gelaufen, wäre es an den Europäern gewesen, sie zu entscheiden. Der von den Republikanern ins Rennen geschickte, erfolgreiche Geschäftsmann, selbstverliebte Medienstar und politische Außenseiter Donald Trump hätte gegen die seit Jahrzehnten mit allen Wassern des Politgeschäfts gewaschene, eiskalte Hillary Clinton nicht den Funken einer Chance gehabt. Sie hätte einen Erdrutschsieg verbuchen können. Für die in ihrer selbstreferenziellen Echokammer gefangenen Mainstreammedienjournalisten kam der Wahlerfolg Donald Trumps völlig überraschend.
weiterlesen
23. Oktober 2020 12:37 | Autor: Herbert Schiller
Ich teile gänzlich die Bedenken hinsichtlich der großen Zahl an Tschetschenen in Österreich, zumal ich elf Jahre als Expat in Moskau gelebt habe, fließend russisch spreche und mir daher bezüglich der spezifischen Probleme sowohl in Russland als auch in Österreich vieles noch deutlicher bewusst ist.
weiterlesen
21. Oktober 2020 16:33 | Autor: Johannes Wohlgemuth
Neulich, nachmittags, in einem Kaffeehaus einer westösterreichischen Metropole. Der Autor bestellt sich einen Kaffee und lässt sich – trotz Gender-Pay-Gaps – von seiner Frau darauf einladen und ihn sich von einer jungen Dame servieren. Plötzlich fällt ihm auf, dass er der einzige Mann in dem Kaffeehaus ist. Was natürlich nicht ganz stimmt, aber eine kurze Zählung ergibt ein Verhältnis von 10:1 zugunsten der Frauen. Eine weitere Beobachtung: Außer ihm und seiner Frau befinden sich (mit Ausnahme des zu 83 Prozent weiblichen Personals) ausschließlich Personen im Kaffeehaus, die augenscheinlich über 75 Jahre alt sind. Das mag jetzt am Nachmittag eines gewöhnlichen Werktags in Anbetracht der Lokalität nicht besonders überraschend sein, ist aber nichtsdestotrotz aufschlussreich.
weiterlesen
21. Oktober 2020 07:20 | Autor: Werner Reichel
Walter Sonnleitner, langjähriger ORF-Wirtschaftsredakteur, hat ein Buch über die Folgen der Corona-Maßnahmen für unsere Gesellschaft geschrieben: Die Corona-Falle. Darin warnt er vor den dauerhaften Einschränkungen unserer Freiheiten und Bürgerrechte. Das spannende Buch ist in meinem Verlag erschienen. Ein Satz daraus gefällt mir besonders: "Nicht alle Menschen im Lande haben sich gehorsam den Verordnungen und Verboten gegenüber verhalten – möglicherweise aus Leichtsinn, oder einfach, weil sie keine richtige Angst vor dem Virus entwickeln konnten."
weiterlesen
20. Oktober 2020 07:18 | Autor: David Nagiller
So unerfreulich das Ergebnis der jüngsten Wiener Landtagswahl für das Mitte-Rechts-Lager – auch über das Land Wien hinaus – im Moment und auch im Hinblick auf die kommenden Jahre ist, so hätte es langfristig durchaus Chancen für die FPÖ geboten.
weiterlesen
19. Oktober 2020 23:49 | Autor: Georg Dattenböck
Verteidigungsministerin Tanner hat heuer wichtige Vorhaben fürs Bundesheer angekündigt. Diese Vorhaben können nur durch eisernes Sparen, nicht nur innerhalb ihres Ressorts, sondern in allen Ministerien realisiert werden. Von diesem Sparwillen bemerke ich als aufmerksamer Steuerzahler und Staatsbürger jedoch nichts.
weiterlesen
19. Oktober 2020 18:10 | Autor: Andreas Tögel
Trotz ihres im Neuen Testament enthaltenen Auftrags zur Trennung von Thron und Altar war und ist die christliche Kirche seit ihren Anfängen nicht unpolitisch. Allerdings hatten ihre politischen Ambitionen in fernerer Vergangenheit stets – das gilt selbst für den Aufruf zum ersten Kreuzzug durch Papst Urban II. im Jahr 1095 – eine stark religiöse Komponente. Das Seelenheil der Gläubigen wurde nie vernachlässigt.
weiterlesen
17. Oktober 2020 08:04 | Autor: Peter F. Lang
Die Westbalkanstaaten, vorweg Albanien und Serbien, sind in der EU auf der Liste der Beitrittskandidaten und werden als solche gefördert, nicht zuletzt auch finanziell. Und zu einem der heftigsten Befürworter von deren Beitritt gehört Österreich, die österreichische Außenpolitik.
weiterlesen
16. Oktober 2020 07:36 | Autor: Andreas Tögel
Der Klimawandel ist anthropogener Natur, meinen EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen und beachtliche Horden meist steuerfinanzierter Klimaapokalyptiker. Muss also so sein. Folglich wurden und werden von der EU "Klimaziele" definiert, die zu erreichen nur mit einer drastischen Deindustrialisierung der Alten Welt, daraus resultierenden Arbeitsplatzverlusten und mit hohen zusätzlichen Kosten für die Insassen der Union möglich sein wird. Um das in 100 Jahren herrschende Klima zu "retten", schreckt die europäische Nomenklatura keine Sekunde lang davor zurück, die Zukunft der heute werktätigen wie auch der in Ausbildung stehenden Generationen aufs Spiel zu setzten.
weiterlesen
15. Oktober 2020 07:27 | Autor: Günter Frühwirth
Das Wiener Wahlergebnis wurde von Experten nach allen Richtungen hin analysiert. Prozentuelle Veränderungen wurden meist nicht relativiert, obwohl z.B. ein Zugewinn von 4 Prozent von 40 auf 44 Prozent eine völlig andere Wertigkeit hat, als eine Verdoppelung des Stimmanteils von 4 auf 8 Prozent. Im ersten Fall hat sich der Wähleranteil um ein Zehntel erhöht, im zweiten Fall jedoch verdoppelt. Wer ist hier also tatsächlich der große Gewinner?
weiterlesen
14. Oktober 2020 07:35 | Autor: Andreas Tögel
Das Führen von Kriegen ist für eine Regierung stets reizvoll, denn ein Krieg – gegen wen oder was auch immer er geführt wird – schart das Volk stets um seine Führer und vergrößert deren Macht. Wer sich in Kriegszeiten gegen ihre Politik stellt, ist ein schäbiger Wicht, ein Verräter, ein "Gefährder", oder, wie eine sozialistische deutsche Spitzenpolitikerin es so ungemein elegant ausdrückt: ein "Covidiot".
weiterlesen
10. Oktober 2020 15:24 | Autor: Elmar Forster
Der Beginn der Hasskampagne gegen Ungarn hat ein Datum, einen Grund und einen Namen: Ende Mai 2010 erlangt Orban die Macht mit einer Zweidrittelmehrheit zurück. Die totalitären Ideologen der Political Correctness zetteln daraufhin eine Hasskampagne von strategischer Impertinenz an: "Wenn nicht die Liberalen die Wahlen gewinnen, dann verkünden diese: Es gibt dort keine Demokratie mehr." (Orban)
weiterlesen
10. Oktober 2020 07:45 | Autor: Stefan Beig
Über die Unfähigkeit der Stadt Wien, rasch Corona-Tests durchzuführen und die Testergebnisse den Betroffenen ebenso rasch zu übermitteln, ist auf diesem Blog schon öfters berichtet worden. Dennoch häuften sich gerade in den vergangenen zwei Wochen Ereignisse, die einen nur mehr ungläubig den Kopf schütteln lassen.
weiterlesen
10. Oktober 2020 00:11 | Autor: Albert Pethö
Wie man jüngst dem Internet und anderen Medien entnehmen konnte, hat ein Herr Menasse in einer an Herrn Blümel gerichteten Botschaft einen mit kühnen Behauptungen versehenen Kommentar zur herannahenden Wahl formuliert. Die zugegebenermaßen etwas vage Absichtserklärung "Wien wieder nach vorne zu bringen", hat Herrn Menasse offenbar erzürnt. "Was ist vorne" wird von ihm nachgefragt; ob es sich um die Zeit vor dem "roten Wien" handeln könne, wird von ihm nachgefragt; "als die Stadt einen antisemitischen Bürgermeister hatte, von dem Hitler lernte", wie Herr Menasse noch anfügt.
weiterlesen
09. Oktober 2020 22:19 | Autor: Reinhard Olt
Das Jahr 2020 erinnert an die Wiedervereinigung Deutschlands 1990, das Trianon-Trauma Ungarns, den Erhalt der Landeseinheit Kärntens sowie die Annexion des südlichen Tirol durch Italien. Der Oktober 2020 zwingt zur Vergewisserung bedeutender Ereignisse, die auf das engste miteinander korrespondieren. Wenngleich nicht auf den ersten Blick zu erkennen, so besteht zwischen der Erinnerung an 30 Jahre Vereinigung der beiden deutschen Rumpfstaaten BRD und DDR, an 100 Jahre Kelsen-Verfassung für Österreich, an 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten, an die territoriale Kastration Ungarns sowie an die formelle Annexion des südlichen Teils des einstigen Kronlandes Tirol durch Italien eine – wenn auch kontrastive, so doch – innere Verbindung.
weiterlesen
08. Oktober 2020 15:49 | Autor: Werner Reichel
Corona hat auch die ein oder andere gute Seite. Der Wiener Wahlkampf ist diesmal weniger penetrant als die vorangegangen. Wesentlich weniger Plakate und Dreieckständer verschandeln das Stadtbild. Trotzdem stoße ich, wenn ich mein Haus verlasse, im Umkreis von 200 Metern auf die Plakate fast aller wahlwerbenden Parteien. Besonders viel Geld dürfte die kommunistische Klein-Partei Links ausgegeben haben. Ihre textlastigen Poster sieht man im Bereich des Rochusmarktes besonders häufig.
weiterlesen
07. Oktober 2020 07:15 | Autor: Peter F. Lang
Wenn man mitbekommt – leider bekommen es viele nicht mit! – wie im "Rechtsstaat" Österreich die individuellen bürgerlichen Freiheitsrechte mehr und mehr unterminiert werden, dann kann einem, muss einem wirklich unbehaglich werden.
weiterlesen