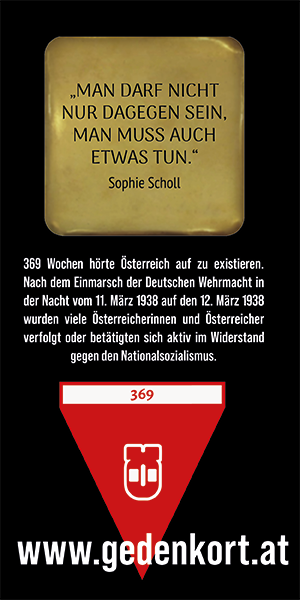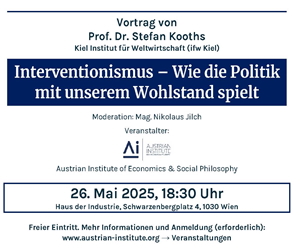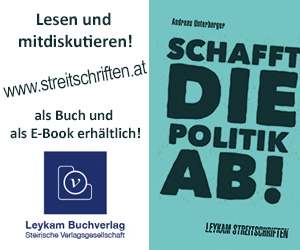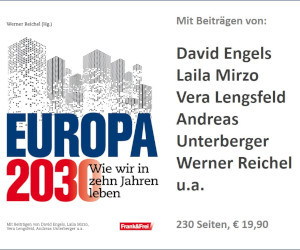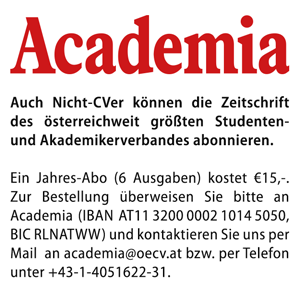In den staatlichen Bildungsinstitutionen gibt es keine "marktwirtschaftliche Aufklärung". Es wird ein "sozialistisch-etatistischer Geist", ein "Vertrauen in die Unfehlbarkeit des Staates" vermittelt. Erkenntnisse von Ludwig von Mises (1881 – 1973), der darauf hinwies, dass "Staatseingriffe Bürokratie erzeugen" und, dass der "Etatismus in den Sozialismus und in den Totalitarismus führt", können in den von einer Bürokratie gelenkten öffentlichen Schulen heute kaum mehr erworben werden.
Mises erkannte, dass "die Marktwirtschaft keinen Sonderinteressen dient". Er kritisierte die "Politik der vereinigten Antimarktwirtschaftler", die "die Gegenwart auf Kosten der Zukunft reichlicher versorgen" (Kapitalaufzehrungspolitik!) und mit ihren Interventionskaskaden (im "Wettbewerb um Privilegien") Sonderinteressen bedienen. Er stellte fest, dass "die Sozialpolitik antisozial ist" und, dass "der Politik die Einsicht in die Folgen politischer Maßnahmen fehlt".
Politiker "glauben, dass es ihre Aufgabe ist, das Verhalten der Bürger zu steuern". Ludwig von Mises engagierte sich für "Privateigentum, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und ein freies Unternehmertum" in einer Marktwirtschaft, die den Bürgern eine "Unabhängigkeit vom Wohlwollen anderer" und des Staates ermöglicht. Die Bürger sollen nicht zu "Knechten der Mehrheit der Privilegienmärkte" werden.
Heute denken die Staatssozialisten in allen Parteien bei ihren (primär) sonderinteressenoriertierten politischen Entscheidungen nicht marktwirtschaftlich. Sie würden damit ihre Karriere innerhalb der oligarchisch strukturierten Parteien und Verbände gefährden. Es geht ihnen vor allem um den Erwerb, um den Erhalt und um den Ausbau politischer Macht.
Der Wettbewerb als Entmachtungsinstrument (in der Marktwirtschaft) gefährdet hingegen die Macht des Staates und von Politikern, die partialinteressenorientierte Interventionen umsetzen und damit einen "Wohlstand für alle" verhindern.
Ein unter Politikern weit verbreiteter "marktwirtschaftlicher Analphabetismus" sowie eine "Tradition der Konfliktvermeidung" fördern die Verhinderung einer Einsicht in die Folgen wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen. Denker der Marktwirtschaft haben heute kaum Möglichkeiten zum Einstieg in die (Partei-)Politik und sie wollen sich die Realverfassungspolitik auch nicht antun.
Marktwirtschaftliche Überlegungen haben auch deswegen immer weniger Einfluss auf politische Entscheidungen.
Josef Stargl ist AHS-Lehrer in Ruhe und ein Freund der Freiheit.