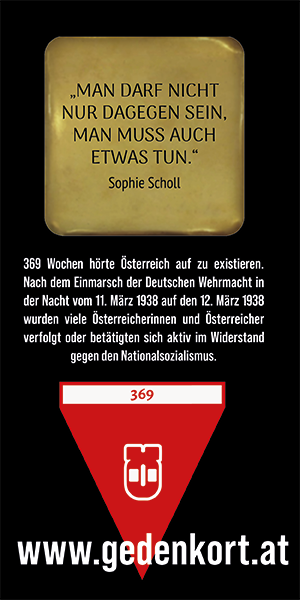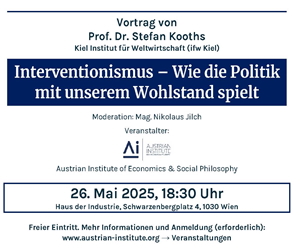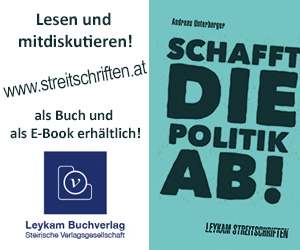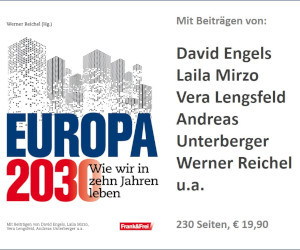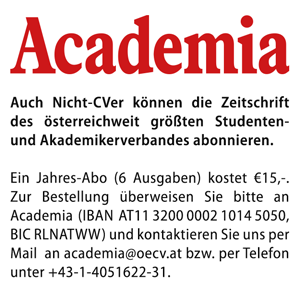Vermutlich werden wir nie erfahren, was der Kardinal und die Bischöfe ihrem Amtsbruder, dem Bischof von Rom, über die Situation der katholischen Kirche in Österreich als Ganzes, und in ihrer jeweiligen Diözese berichtet haben. Warum eigentlich?
Mit welchem Recht wird hier ein Bericht über uns abgegeben, von dessen Inhalt wir nichts wissen dürfen? In früherer Zeit war es selbstverständlich, dass der Quinquinalbericht in der Diözese unter Mitwirkung des Klerus und der Laien erstellt wurde. Gemeinsam haben sie ein Bild der Diözese gezeichnet. Als ehrenamtlich tätige Laien, die das ganze Jahr in und für ihre Diözese, und darüber hinaus auch österreichweit arbeiten, haben wir wohl das Recht hier mitzureden. Mitarbeiten heißt mitgestalten und heißt Mitverantwortung tragen.
Was vom Bericht des Kardinals in Rom zu erwarten ist, zeigt sein Interview, das er gegenüber Radio Vatikan gegeben hat, schonungslos auf:
Da ist zunächst die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Pfarrer-Initiative, die Schönborn dahingehend beantwortet, dass es sich „bei den Priestern, die den Aufruf (zum Ungehorsam) gemacht haben, wirklich nur um einen ganz kleinen Prozentsatz, fast im Promille-Bereich, handle“. Sieht man sich die konkreten Zahlen an, so entpuppt sich der kleine Prozentsatz als nicht zu vernachlässigende Größe: In Österreich gibt es knapp 4.000 Ordens- und Weltpriester und 650 ständige Diakone. Von diesen sind 416 Priester (knapp über zehn Prozent) und 93 Diakone (rund 14 Prozent) Mitglied der Pfarrer-Initiative.
Betrachtet man deren Altersdurchschnitt von 59 Jahren, zeigt sich, dass es sich hier vorrangig um Priester/Diakone handelt, die – im Unterschied zum Herrn Kardinal – über eine jahrzehntelange praktische pastorale Erfahrung verfügen, und aus eigener, oft leidvoller Erfahrung wissen „wo der Schuh wirklich drückt“. Hier wird seitens des Kardinals versucht, eine Personengruppe zu marginalisieren, die das weder quantitativ, und schon gar nicht qualitativ verdient hat. Nicht zu vergessen die rund 75 Prozent aller Priester und Diakone, die bei einer bundesweiten Befragung ihre Sympathie gegenüber der Pfarrer-Initiative bekundet haben, dieser aber aus Sorge um ihre berufliche (= pastorale) Arbeit nicht beitreten wollen oder können (was alleine für sich schon ein eigenartiges Bild auf die innerkirchliche Situation wirft).
Die Aussage des Kardinals ist daher eine Desavouierung des überwiegenden Teils des Klerus. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie der Herr Kardinal in Zukunft dem Ratschlag, den er beim Treffen mit Papst Franziskus von diesem erhielt, „Seid Euren Priestern nahe“, nachzukommen gedenkt.
(Nebstbei stellt sich die Frage, wie jemand, der so leichtfertig mit Zahlen umgeht – indem er etwa die Größenordnung von zehn bis 14 Prozent im Promillebereich ansiedelt – seine Funktion im Aufsichtsrat einer (Vatikan-) Bank wahrnehmen will.)
„Von Papst Franziskus lernen wir, dass sich die Kirche nicht übermäßig mit ihren Strukturen beschäftigen solle“, meint der Kardinal, um im gleichen Atemzuge mit der Bemerkung „Das Thema Gemeinschaft habe Vorrang vor der Frage territorialer Zugehörigkeit“ genau der Intention von Papst Franziskus zu widersprechen (und damit der Praxis seiner Mitbrüder in Klagenfurt oder Salzburg, die klar gesagt haben, dass es in ihrem Bereich keine Pfarrzusammenlegungen geben werde). Und weiter „Menschen fänden sich dort ein, wo sie eine lebendige Glaubensgemeinschaft finden, und nicht dort, wo sie territorial hingehören“.
Der Kardinal übersieht dabei aber, kraft fehlender eigener Erfahrungen, dass das Idealbild darin liegt, die lebendige Glaubensgemeinschaft dort zu finden, wo man territorial hingehört. Mit der ständigen Gründung neuer Bewegungen und deren einseitiger Förderung verhindert der Kardinal geradezu den Erhalt bestehender und funktionierender bzw. die Bildung neuer idealtypischer Glaubens- (= Pfarr-) Gemeinschaften. Lebendige Gemeinde, die alle und alles einschließt, kann nämlich nur dort wachsen und gedeihen, wo die Menschen leben. Hunderte Beispiele in Österreich stehen dafür.
Elitäre Zirkel können/sollen dabei eine wertvolle Bereicherung/Ergänzung dessen, niemals aber Ersatz dafür sein, da sie nur einen kleinen Teil des spirituellen – und kaum einen des caritativen – Spektrums abdecken. Pfarre versteht sich als Heimat – von der Wiege bis zur Bahre.
Auf der Homepage der vom Kardinal geförderten Plattform „Jakob“ findet sich unter „ad limina“ eine bemerkenswerte Aussage des 2002 verstorbenen Kurienkardinals Francois Xavier Nguyen Van Thuan gegenüber seinen vatikanischen Mitarbeitern: „Ein ganz konkreter Bereich, in dem wir diesen unseren typischen Dienst der Gemeinschaften (gemeint sind damit die Bewegungen) verwirklichen können, ist zweifellos die Aufnahme der Bischöfe während ihres Ad-limina-Besuches. Die Besuche ad limina sollen ein besonderes Moment jener Gemeinschaft darstellen, die für das Wesen der Kirche so grundsätzlich entscheidend ist.“
Diese Anmaßung darf nicht unwidersprochen bleiben. Grundsätzlich entscheidend für das Wesen der Kirche sind wohl alle die Gläubigen – Kinder, Jugendliche, Erwachsene jeden Alters, Alleinstehende oder Verheiratete, Männer und Frauen – die das ganze Jahr über in den Pfarren, Dekanaten und Diözesen, ob in Jungschar, Jugend, Frauen- und Männerbewegung, Familienrunden, als Tischväter und Tischmütter, oder als Firmgruppenleiter pastoral tätig sind: In ihren Händen liegt die Zukunft der Kirche. Sie gehen, der Aufforderung unseres Bruders Franziskus folgend, zu den Randgruppen, den Gescheiterten, den Verzweifelten, den Alten und Kranken – und bringen ihnen die Frohbotschaft. Ihnen fehlt oft die Zeit, um sich im Kreis um eine Kerze zu setzen und zu singen (ohne das abwerten zu wollen), ihnen fehlt oft diese Zeit für sich, da sie sich eben den anderen widmen.
Die Behauptung des vietnamesischen Kardinals, die auch von seinem österreichischen Amtsbruder bei jeder Gelegenheit unterstrichen wird, wonach die Gemeinschaften (Bewegungen) „für das Wesen der Kirche so grundsätzlich entscheidend“ seien, ist ein Schlag ins Gesicht und eine Desavouierung des Engagements des Großteils der ehrenamtlich tätigen Laien in den Pfarren.
Mit seiner einseitigen Förderung bzw. Bevorzugung der Bewegungen hungert Kardinal Schönborn die gewachsenen Pfarrstrukturen mit allen ihren oben genannten Einrichtungen und Gruppierungen personell und materiell aus – um dann festzustellen, dass viele der Pfarren nicht überlebensfähig sind.
Und letztlich sind es die Aussagen unseres Kardinals zur Vatikan-Umfrage, die am Wahrheitsgehalt seines Berichtes an den Bischof von Rom Zweifel aufkommen lassen. Schönborn spricht von 30.000 Teilnehmern an der Befragung. In Wahrheit waren es 42.500. Geflissentlich verschweigt der Kardinal dabei etwa die rund 4.000 Teilnehmer an der Befragung der Katholischen Aktion, die etwa 4.000 Teilnehmer an der gemeinsamen Befragung der Laieninitiative und von „Wir sind Kirche“ und die 1.100 Teilnehmer aus der Jugend. Auch verschweigt der Herr Kardinal wohlweislich, dass die Erzdiözese Wien wenig dazu beigetragen hat, dass sich mehr Menschen an der Befragung beteiligen. Offensichtlich war man in Wien (wie auch in St. Pölten) an der Befragung und dem zu erwartenden Ergebnis gar nicht interessiert. Hier wurde klar gegen die Intentionen von Papst Franziskus gehandelt.
Es stellt sich aber auch die Frage, ob der Herr Kardinal meint, sich mit der Ablieferung des Ergebnisses der Befragung in Rom seiner Aufgabe und Verantwortung entledigt zu haben. Papst Franziskus weist stets darauf hin, dass er, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, den nationalen Bischofskonferenzen mehr Eigenverantwortung überlassen möchte. Die leidige Ausrede, „Rom wünscht das nicht“, hat damit ausgedient. Unsere Bischöfe werden daher in Zukunft noch mehr daran zu messen sein, wie ernst sie die in der Befragung geäußerten Anliegen der Gläubigen nehmen, und welche Maßnahmen sie zur Verbesserung der Situation treffen. Dann müsste man in fünf Jahren die Fragebögen neuerlich versenden um zu sehen, auf welchen Gebieten eine Verbesserung eingetreten ist und auf welchen nicht. Und die Bischöfe müssen sich dann die Frage gefallen lassen, was sie dazu beigetragen oder was sie unterlassen haben.
Wenn der Herr Kardinal im Interview meint, „man sehe (etwa bei der Berichterstattung über die Pfarrerinitiative) den Unterschied zwischen dem, was medial transportiert wird und dem, was Realität der Kirche ist“, dann kann man das 1:1 auf seine Berichterstattung in Rom umlegen. Auch bei dieser sieht man den Unterschied zwischen dem, was, zumindest der Berichterstattung nach, dorthin transportiert wird, und dem, was Realität der Kirche ist.
Es ist daher zunächst zu verlangen, dass die Berichte, die nach Rom gegangen sind, offen gelegt werden.
Prof. Urrisk-Obertynski ist Brigadier in Ruhe. Er war bislang eher als Kommentator für Fragen der Sicherheitspolitik und Landesverteidigung und als Autor von militärischen Sachbüchern zur österreichischen Militärgeschichte bekannt. Daneben ist er aber seit 40 Jahren auch ehrenamtlich in verschiedenen Leitungsfunktionen im Laienapostolat auf diözesaner, nationaler und internationaler Ebene tätig und engagiert sich als solcher für notwendige Reformen in der Kirche.