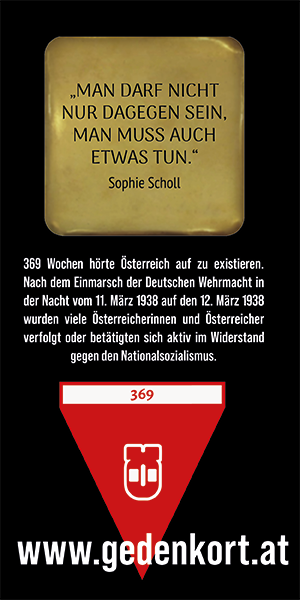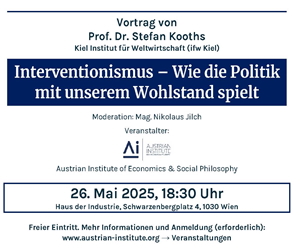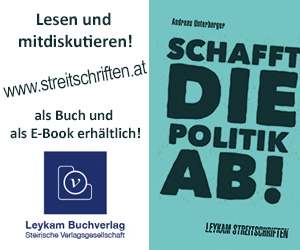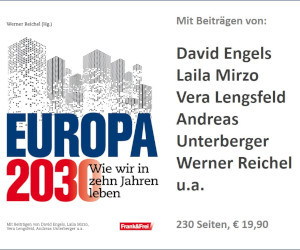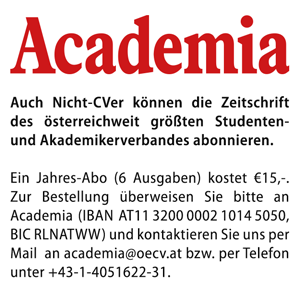Derzeit touren die sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Österreichs und Deutschlands durch die Lande und rechtfertigen ihre Steuererhöhungspläne mit dem Argument, dass nur eine Minderheit von einem bzw. fünf Prozent betroffen wäre. Machen wir uns über dieses Quantitätsargument einmal demokratiepolitische Gedanken.
Zunächst erscheint die Sache ja demokratisch in Ordnung zu gehen. Warum sollen in einer Demokratie nicht 95 Prozent beschließen dürfen, dass die restlichen fünf Prozent überproportional enteignet werden? Mehrheit ist schließlich Mehrheit.
Es wäre in Ordnung, wenn es nicht die Grund- und Freiheitsrechte gäbe. Jedermann weiß, dass 95 Prozent der Wähler nicht beschließen können, dass die übrigen fünf Prozent gehängt werden.
Zu diesen Grund- und Freiheitsrechten gehört auch der Gleichheitsgrundsatz, der es schon prinzipiell erschwert, eine bestimmte Minderheit – und auch die Wohlhabenden stellen eine Minderheit dar – ungleich zu behandeln.
Gerade Sozialdemokraten müssen also über ihr Gleichheitspostulat springen, wenn sie die Wohlhabenden mit einer Sondersteuer belegen wollen.
Besonders pikant erscheint diese Sondersteuer unter dem Gesichtspunkt, dass es gerade die von demokratischen Politikern erkämpfte Chancengleichheit gewesen ist, die diese ungleiche Vermögensverteilung stark begünstigt hat. Wenn ein Wlaschek, ein Mateschitz oder auch ein Schlaff heute zu den reichsten Österreichern zählen, dann verdanken sie diesen Wohlstand in erster Linie ihrer eigenen Tüchtigkeit in einem nicht privilegierten Umfeld.
Wer also das Vermögen der genannten Herren im Namen der Gerechtigkeit angreifen möchte, sagt implizit, dass die Chancengleichheit zu einem unerwünschten Ergebnis, nämlich einer Ergebnisungleichheit, geführt hat.
Letztlich bedient ein solcher Ungerechtigkeitssinn nur den Neid, der in Wirklichkeit gar nicht so verbreitet ist, wie die Politiker glauben. Wenn an jedem Wochenende 22 reiche Menschen vor Zehntausenden Armen um einen Ball spielen – die für das Zuschauen auch zahlen – und selbst eine Steuernachzahlung eines Herrn Messi von zehn Millionen Euro keine Proteststürme auslöst, erscheint die Neidverbissenheit der Menschen gar nicht so ausgeprägt.
Im Übrigen hat die Entfesselung des Neides in der Geschichte niemals vor den Reichen Halt gemacht. Schon in der französischen Revolution endete das, was man mit dem Slogan „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ begann, mit tausenden und abertausenden Toten. Auch die Enteignung der weißen Farmer in Simbabwe hat nicht zu mehr Gerechtigkeit, sondern zu Nahrungsmittelknappheit geführt. Jeder mag sich seine eigenen Beispiele finden, wenn Minderheiten im Namen des Neides der gesellschaftlichen Aggression ausgeliefert wurden.
Auch die Minderheit der Reichen verdient den Schutz der Gesellschaft, die von dieser Minderheit umso mehr profitieren wird, je größer sie ist. Wer nicht die gleichmäßige Verteilung der Armut anstrebt, muss die ungleiche Verteilung des Reichtums in Kauf nehmen. Nicht weniger Reiche, sondern mehr Reiche zu haben muss daher das Ziel einer erfolgreichen Politik sein.
Dr. Georg Vetter ist selbständiger Rechtsanwalt mit Schwergewicht auf Gesellschaftsrecht und Wahrnehmung von Aktionärsinteressen in Publikumsgesellschaften.