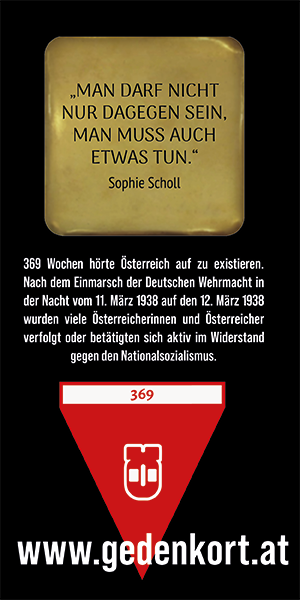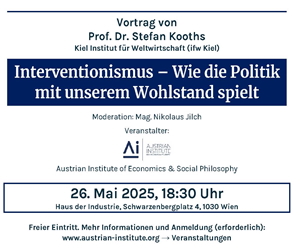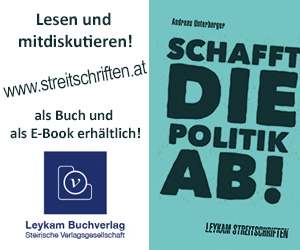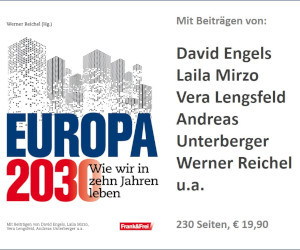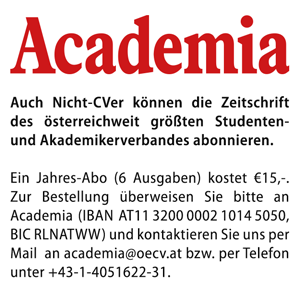Am 20. Mai 1927 startete Lindbergh zu seinem Alleinflug von New York nach Paris. Aus Gewichtsgründen hatte er zugunsten maximaler Treibstoffzuladung auf Funkgerät und Sextant verzichtet und war deshalb nur auf Karten und Kompass angewiesen. Nicht einmal hundert Jahre später haben bereits Tausende Flugzeuge den Atlantik non-stop mit Mannschaften und Passagieren sicher überquert. Voraussetzungen dafür waren zunehmend innovative Technik, gut entwickelte Sicherheitsstandards, Organisation, etc.
Wegen der Leistungsanforderungen, dem notwendigen intelligenten Betriebsverhalten und der Sicherheit steuert heutzutage mehr und mehr Software unsere Flugzeuge und andere Transportmittel. Dabei tritt zwischen Intention und angestrebter Wirkung ein Widerspruch auf, für den bereits ein Name geprägt wurde, nämlich „automation paradox“ (Automatisierungs-Paradoxon).
In der „flagship publication“ der IEEE (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, gegründet 1884, widmet sich dem Nutzen der Menschheit zum Erzielen von Fortschritten durch Innovation und Technologie und ist die größte technische Berufsvereinigung auf allen Gebieten der Elektrik, Elektronik und der Computer und den damit verbunden Wissenschaften und Technologien der modernen Zivilisation), dem „IEEE Spectrum magazine“, gibt es unter “Aerospace” einen Blog, der sich mit der Analyse von Computer Projekten bezüglich, Software- und Systemfehler, aber auch mit Fortschritten bezüglich Innovationen, Sicherheitsgefährdungen, etc., befasst.
Im Blog // The Risk Factor (12. Dez. 2011) geht dort R. Charette am Beispiel des Unglücksfluges „Air France 447“ auf das Automatisierungs-Paradoxon näher ein: In den frühen Morgenstunden des 1. Juni 2009 stürzte das Flugzeug mit der Flugnummer „Air France 447“ in den mittleren tropischen Atlantik, wobei 228 Menschen starben. Für fast zwei Jahre blieb die Unglücksursache ein Rätsel. Erst im Mai 2011 konnte nach langer und intensiver Suche der aus 3500 Metern Wassertiefe geborgene „Data Recorder“ bei einer Pressekonferenz gezeigt werden.
Im August 2011 veröffentlichte das französische Amt für Flugsicherheit „BEA“ ein Schriftstück mit der Transkription der Aufzeichnungen des „Voice Date Recorder“. Darauf nahm in einem neuen Buch „Erreurs de Pilotage“ der französische Fluginstruktor Jean-Pierre Otelli Bezug:
„Wir wissen nun, dass AF447 Wolken eines starken Gewitters durchflog, wobei die Geschwindigkeitssensoren vereisten, worauf der Autopilot selbsttätig ausgeschaltet wurde. Im darauffolgenden Durcheinander verloren die Piloten die Kontrolle über das Flugzeug, weil sie unrichtig auf die Instrumentenhavarie reagierten und dann unfähig schienen, das Wesen des Problems, das sie verursacht hatten, zu verstehen. Weder Wetter noch Funktionsfehler verdammten AF447 zum Absturz noch eine komplizierte Kette von Fehlern, sondern ein einfacher aber beständiger Fehler auf Seiten eines der Piloten.“
In einer Presse-Aussendung verurteilte das Flugsicherheitsamt BEA diese Bekanntmachung wegen mangelndem Respekt vor den Crew-Mitgliedern und wegen der Tatsache, dass die Untersuchung offiziell noch nicht abgeschlossen sei.
Im Sinne des Automatisierungs-Paradoxons lautet dazu die Anmerkung des Magazins „Popular Mechanics“:
„Der Absturz lässt die verstörende Möglichkeit erkennen, dass das Flugwesen ziemlich lange von einer feineren Plage bedroht werden könnte, die ironischerweise dem niemals endenden Bestreben entspringt, das Fliegen sicher zu machen. Über Jahrzehnte hinweg wurden Flugzeuge mit zunehmend automatisierten Flugkontrollfunktionen ausgestattet. Diese haben die Fähigkeit, einen Großteil an Unsicherheit und Gefahr beim Fliegen zu beseitigen. Aber sie entfernen auch wichtige Informationen aus dem Augenmerk der Besatzung.
Während die Flugzeugsausstattung entscheidungsrelevante Parameter wie Position, Geschwindigkeit und Flugrichtung ausfindig macht, kann der Mensch auf anderes achten. Aber wenn Probleme plötzlich aufkommen und der Computer entscheidet, dass er nicht länger zurecht kommen kann – in einer dunklen Nacht, vielleicht in Turbulenzen, weit vom Land – dann können sich die Menschen in einer sehr lückenhaften Vorstellung darüber wiederfinden, was vorgeht. Sie werden sich fragen: Welche Instrumente sind zuverlässig und welchen kann man trauen? Was ist die dringlichste Gefährdung? Was geht eigentlich vor?
Bedauerlicherweise wird die überwältigende Mehrheit an Piloten wenig Erfahrung bei der Antwortfindung haben.“
Leser, die die zitierten Beiträge im Original lesen wollen, finden diese unter
http://spectrum.ieee.org/riskfactor/aerospace/aviation/air-france-flight-447s-final-minutes-reconstructed
bzw. inklusive der Aufzeichnungen des Voice data recorders (französisch/engl.) unter:
http://www.popularmechanics.com/technology/aviation/crashes/what-really-happened-aboard-air-france-447-6611877
Dipl.-HTL-Ing. Alfred Kraker, war Zeit seines Berufslebens in Forschung und Entwicklung eines großen internationalen Unternehmens tätig; er war zuletzt Leiter einer Entwicklungsabteilung für digitale Signalverarbeitung. Fachspezifische Veröffentlichungen und rund 100 Patente sind mit seinen Arbeiten verknüpft.