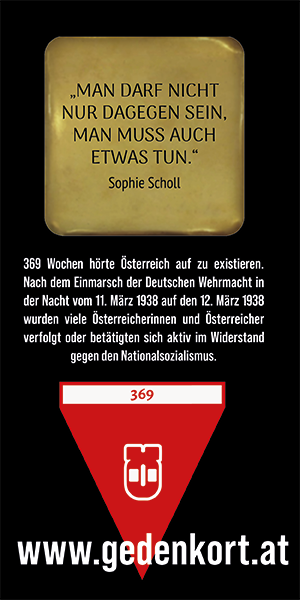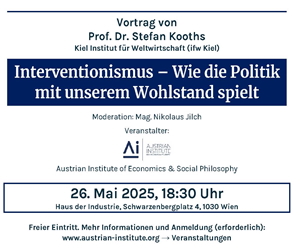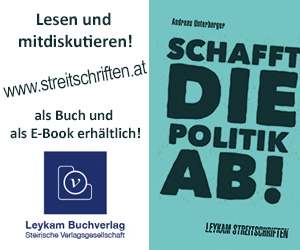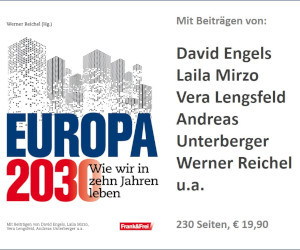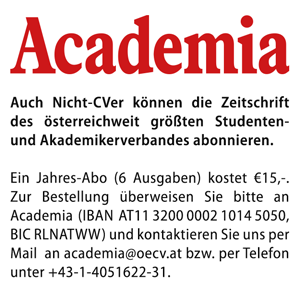Irgendwie sind die Theoretiker des Kollektivismus in der Schuldzuweisung doch konsequent: Wo immer ein Verbrechen begangen wird, sucht sie die Schuld nicht beim Täter, sondern beim politischen Gegner.
Als in den siebziger Jahren die RAF Deutschland mit ihren Terroranschlägen überzog sollte, „das System“ daran schuld sein. Der Kapitalismus hatte Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Genossen angeblich zu jenen Gegnern des herrschenden Systems gemacht, die nicht anders konnten, als mit Waffengewalt ihrer Frustration Ausdruck zu verleihen.
Wenn heutzutage ein Herr B. in Norwegen einen Terrorakt verübt, sollen wiederum andere daran schuld sein: Nämlich jene, die beispielsweise vor der Islamisierung Europas gewarnt haben. Kaum auszudenken, welche Theorien mit einer Verallgemeinerung eines solches Ansatzes vertretbar wären.
Jede attackierte Schwiegermutter könnte – gesamtgesellschaftlich gesehen – als ein Opfer aller Schwiegersöhne gesehen werden, die durch ein einmaliges böses Wort gegen die ungewollte Verwandte ein Klima der Intoleranz geschaffen haben. Wer die modernen Theoretiker der Kollektivschuldthese agieren sieht, mag sich fragen, was diese den (ewig)gestrigen Theoretikern ähnlicher Thesen intellektuell entgegen zu setzen haben.
Unsere moderne Strafrechtskultur baut auf dem Grundgedanken der Individualschuld auf. „Keine Strafe ohne Schuld“ ist ein Prinzip des Strafgesetzbuchs. Wäre „das System“ oder irgendwelche politische Bewegungen an Verbrechen schuld, dürften wir die Verbrecher gar nicht verurteilen.
Gerade ganz furchtbare Verbrechen rufen uns in Erinnerung, dass Freiheit auch bedeutet, dass sich der einzelne für das Böse entscheiden kann. Manche wünschen sich eine idealisierte Welt herbei, in der das Böse ausgerottet ist und alles Schlechte ein Auswuchs von Krankheit sei. Damit wäre das Prinzip der Verantwortung für das eigene Tun allerdings abgeschafft.
Dass wir Menschen nicht nur frei sind, Gutes zu tun, sondern auch Böses zu verbrechen, mag für einige erschreckend sein. Genau genommen liegt darin das „Drama der Freiheit“, weil uns niemand die Verantwortung für unser eigenes Tun abnimmt. Dass auf der anderen Seite jeder Mensch auch für das Gute, das er begeht, verantwortlich zeichnet, mag für die einen ein Trost sein. Für die anderen ist es eine Quelle von Hoffnung und Gerechtigkeit.
Dr. Georg Vetter ist selbständiger Rechtsanwalt mit Schwergewicht auf Gesellschaftsrecht und Wahrnehmung von Aktionärsinteressen in Publikumsgesellschaften.