Vernunft-Aufklärung gegen Hybrid-Aufklärung
Man könnte meinen, Kants kritisches Zeitalter sei wiedergekehrt, wenn wir lesen, dass die Europäische Kommission und die UNESCO "das kritische Denken" als neue "Schlüsselkompetenz im Umgang mit KI-Anwendungen" preisen. Siehe hier und hier.
Doch um die Frage zu beantworten, ob eine reale oder eine nur eingebildete Wiederkehr stattfindet, sind wir in der glücklichen Lage reicher Erben: Kants Definitionen von "Kritik" und "kritischem Denken" wurden im Staub der 250-jährigen Geschichte seit 1781 noch nicht gänzlich verschüttet und vergraben.
"Sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen", dieser Leitspruch seiner Schrift "Was ist Aufklärung", leuchtet immer noch in unser Jahrhundert herüber, vielleicht verblassend, vielleicht nur mehr halb verstehbar. Doch immer noch wie eine unverrückbare Mahnung an alle Zeiten und Kulturen, die eine Fremdherrschaft über und für das Denken der Menschheit zugelassen haben und nun wieder zulassen, obwohl unsere Vernunft nur als Selbstherrscherin ihre Selbstachtung bewahren und weitergeben kann.
Allerdings meinte Kant zugleich, dass diese Selbstachtung ohne Mut und (Vernunft-)Arbeit weder zu erobern noch zu bewahren sei. Offensichtlich schwebte ihm eine (neue) Menschheit vor, deren Selbstachtung mit ihrer Achtung vor ihrer Vernunft in Einklang lebt: ein erreichbarer Gipfelgrat, von dem abzustürzen, umso fataler und grausamer sein würde, weil eine Menschheit, die alle vormodernen Verblendungen und Versklavungen hinter sich gelassen hat, ihren Absturz in die früheren Niederungen bei vollem Bewusstsein erfahren wird, – erstmals ohne ablenkende und beschwichtigende Narkotika.
Ist nun das "kritische Denken" mit KI-Anwendungen auf gutem Kurs und daher sogar über Kants fordernde Prinzipien hinaus, oder fällt es hinter die Prinzipien der (Vernunft-)Aufklärung so hoffnungslos zurück, dass der Mensch neuerlich als Schuldiger verfehlter Dogmen in unbekannt neuen "Hexenprozessen" verurteilt und auf gänzlich neuartigen "Scheiterhaufen" öffentlich verbrannt wird?
Er könnte im Morast verunmündigender Meinungsdiktaturen verelenden, und seine (frei denkende und redende) Vernunft würde allmählich verstummen. Wissenschaftliche oder auch religiöse Muftis würden für ihn denken und reden, und vor dem machthabenden Kadi einer neuen Unrechtskultur ließe sich sein Schicksal nur noch beweinen.
Ob das heutige Europa und die westliche Welt insgesamt bereits an diesem Scheideweg stehen, vermag wohl niemand mit Gewissheit zu sagen. Wohl aber, dass Kants Vernunftoptimismus radikal gedämpft wurde. Die Geschichte nach 1804 wählte auch radikal unvernünftige Wege. Doch mit der "Schlüsselkompetenz im Umgang mit KI-Anwendungen" könnte das 21. Jahrhundert die Irrwege des 19. und 20. Jahrhunderts vermeiden?
Während Kant offenbar der Meinung war, unser Verstand enthalte bereits ausreichend viele und begründete Kriterien und Begriffe, um "aufgeklärt" denken zu können, dominiert unter den heutigen "Usern" der KI-Anwendungen die Ansicht, dass sich bislang noch keine verbindliche Definition des Begriffs "kritisches Denken" durchgesetzt habe. Woraus unmittelbar folgt, dass Kants "Stammbegriffe des Verstandes" veraltet, "wissenschaftlich überholt" und möglicherweise sogar "rassistisch" sein könnten.
Wie verbindlich ist Verbindlichkeit?
Und weil "Verbindlichkeit" ohnehin ein fragwürdiger und "umstrittener" Begriff sei, müssen nun auch alle KI-Anwendungen mit "Grundbegriffen unter Vorbehalt" operieren. (Jeder Grundbegriff unseres vernünftigen Verstandes könnte vielleicht nur ein Meinungsbegriff mit baldigem Ablaufdatum sein. Auch die Mathematik wird noch andere Tage erleben, und erlebt sie – KI-unterstützt – schon jetzt. Die Gleichung 2+2=4 ist ein interessanter Vorschlag, mehr nicht.)
Dagegen wandte Kant ein, dass die Vernunft unseres Verstandes keine (geschichtliche) Ablaufsache und auch keine (evolutionäre) Anlaufsache sein könne, weil wir in diesem Fall viele verschiedene (gewesene) Menschheiten und überdies auch neue Menschheiten, (nach heutigem Stand: solche mit vererbbar eingeborenen KI-Anwendungen, frei wählbaren Geschlechtern, rasselosen Rassen u.a.m.) annehmen müssten.
Die besagte ("unumstrittene") Vernunft müsse daher "apriori" (radikal übernatürlich) in uns verankert sein.
An diesem "Dogma" seiner Vernunftaufklärung, haben sich nach Kant ganze Legionen von Wissenschaften und Ideologien abgearbeitet, von Marx über Darwin bis Einstein, ebenso Heerscharen von Soziologen, Psychologen und Radikalhistorikern, die schon immer wussten, dass alle Kulturen und deren Begriffe in unmittelbar Nähe zum Nabel der Welt logieren. (Was allein schon durch die Vielfalt der Sprachen bewiesen sei.)
Doch felsenfest, wie Moses auf Sinai, hielt Kant an seinem universalen Grunddogma fest: Ohne die Grundbegriffe der Quantität, Qualität, Relation und Modalität hätten wir keine Welt – weder in uns – noch rund um uns herum.
Adam Rieses Einwand
Doch weil sowohl die Vorgeschichte, die zu Kants Vernunftaufklärung führte, wie auch die Nachher-Geschichte, die Kants System nach Strich und Faden zerlegte, für unsere KI-Intelligenz mit einhundertundeintausend Texten auf Abruf bereitsteht, ist unsere Vernunft – nach Adam Riese –"einhundertundeintausendmal" aufgeklärter als die des Altvaters aus Königsberg. Und seitdem ein neuer wissenschaftlicher Tiefblick auch noch seinen versteckten Rassismus aufgedeckt hat, ist kein Halten mehr: Die neue Aufklärung hat ihren unüberbietbaren Höhenflug – per aspera ad astra – begonnen.
Für seine Art von Aufklärung hatte sich Kant auch von den Revolutionen seiner Epoche anregen lassen. Und darüber hinaus von vielleicht 30 bis 50 Schriften seiner Mitstreiter in England und Frankreich. "Quellen", die er nicht ohne Mühsal aus Bibliotheken heranschaffen ließ, und wenn er seine Schriften zum Thema veröffentlichen wollte, musste er Zensur-freundlich formulieren, um nicht ein kirchliches "Obstat" oder ein Publikationsverbot seiner Fakultätsleitung zu provozieren. Sein Handicap gegenüber den KI-Gelehrten von heute war zum Verzweifeln. Und gegen die Angriffe der "neuen Aufklärung" unserer Zeit sich zu wehren, wäre ihm unmöglich gewesen, weil er von der radikal neuen Zukunft, die nach seinem Tod anbrechen sollte, nichts wissen konnte.
Wieder einmal stehen wir vor dem geheimniserfüllten Satz: "Alles hat seine Zeit." Und was seine Zeit erfüllt hat, ist durch eine zweite Zeit lediglich künstlich ("historisch", denkmälerisch, rituell-kultisch usf.), nicht aber wirklich wiederholbar. Die Weiterfahrt der Lokomotive Menschheit ist daher immer schon unterwegs, sie schaut nach vor und fragt: "Wie geht es weiter?", oder realitätsnäher: "Wie kann es "überhaupt noch weitergehen?"
Jetzt ist die Zeit der KI-Aufklärer mitten unter uns, sie befragt Kant nicht mehr mit seinen Begriffen und Kategorien, weil sie überzeugt ist, dass deren Zeit abgelaufen ist. Daher stellt sie auch (noch) nicht die Frage, ob vielleicht gerade heute ein neuer Kant nötig wäre, um aus dem Wust der Irrtümer und Irrwege, die uns neuerdings umnebeln, herauszufinden.
Haben wir nicht neue Philosophen und neue Wissenschaften "in Hülle und Fülle" – somit eine gänzlich neue Grundlage für eine gänzliche neue Aufklärung?
Noema und Noesis
Um nun zu veranschaulichen, was beide Aufklärungen auf der Ebene der Prinzipien und Grundlagen unterscheidet, kann ein kurzer Rückgriff auf die ehrwürdigen Begriffe der antiken Philosophiegeschichte zweckdienlich sein. Denn der griechische Unterschied zwischen "Noema und Noesis" ist "im Prinzip" auch der Unterschied von alter (Vernunft-) und neuer (Hypervernunft-)Aufklärung.
Beispielsweise ist die berühmte Hypotenuse des Pythagoras ein Noema, sie ist keine Noesis, obwohl viele Noesis den Zugang zur Vernunftrealität "seiner" Hypotenuse ermöglicht und eröffnet haben. Sie ist ein Faktum unserer mathematischen Vernunft und diese geht allen ihren, längst nicht mehr benötigten Hypothesen und Konstruktionen voraus, seitdem die Geltung von Pythagoras‘ Beweis unumstritten ist.
Dass besserwissende "Fachexperten" dennoch bis ans Ende der Menschheitstage ihre "Widerlegungen" des Pythagoras und der 2+2=4-Gleichung präsentieren werden, darf man als vernünftige Prophetie voraussetzen. Begründung: Ein Milliarden-Super-Subjekt, dessen Vielfalt unüberbietbar sein muss, verfügt über Millionen Originalgenies und Kreative, die schon aus Langeweile alle langweiligen ("immergleichen") Lösungen der "Altvorderen" ablehnen müssen. Ihre originellen und kreativen Überraschungen können uns jedoch nicht mehr überraschen. Schon die antiken Skeptiker haben sich als unüberbietbare Genies des Konstruierens und Dekonstruierens präsentiert: Eigentlich existiert nur ein Ding und nur eine Sache: Nichts und Nichts als Nichts.
Kant und die Religion(en)
Eine zentrale Frage der Vernunftphilosophie Kants war bekanntlich: Was ist der Mensch?
Die Antworten der Religionen (er ist ein Geschöpf Jehovas, ein Geschöpf Allahs, ein Geschöpf des Dreieinigen Gottes) konnten ihn nicht mehr überzeugen, weil er beim Versuch, die in den heiligen Schriften verlautbarten Schaffensakte Gottes zu verstehen, auf eine Leere und Willkür stieß, die ihn abschreckte und am Verstand der Glaubenden aller Religionen verzweifeln ließ. Ein Gott, der durch sein Sprechen erschafft, ein Gott, der durch sein Kneten von Staub und Lehm erschafft, ein Gott, der aus der Rippe eines Menschenwesens ein anderes Menschenwesen derselben Art erschafft, erhärtete Kants Verdacht auf einen Betrug durch selbst Betrogene, deren Märchen der heutigen, nicht mehr kindlichen Menschheit nur noch als wirkliche Märchen erscheinen können.
Indem Kant am Vernunftwesen Mensch als Noema festhielt, konnte er zugleich noch an einer Philosophie festhalten, die sich als zentrale Definitionsmacht der aufgeklärten Menschheit begründete und behauptete. Noch stand die Phalanx neuer und gleichberechtigter Wissenschaften außerhalb des Kampfeldes, auf dem heute um das wahre Wesen des Menschen gefochten wird.
Und Kants Definitionen von Menschenrechten, die davor noch nicht verbindlich (!) in der Welt gewesen waren, wurden von christlichen und anderen religiösen Offenbarungssprüchen allenfalls angeregt. Um daher nicht als religiöse Offenbarung missverstanden zu werden, mussten die neuen Rechte - so zu reden - in Vernunft gemeißelt sein, in die Fundamente der Vernunft jedes Menschen. Mochte dieser Mensch mit seiner oder einer anderen oder auch mit keiner Religion Freundschaft geschlossen haben.
Für den Apostel Paulus war es gleichgültig, ob der Mensch als freier oder als Sklave sein Leben lebte, denn der Hauptzweck des Menschenlebens hatte in Christus und dessen Dienst ein in die Ewigkeit gemeißeltes Ziel erhalten. Seitdem ist der (fast immer konfliktreiche) Gegensatz zwischen der Autonomie der moralischen und denkenden Vernunft des Menschen und seiner religiösen Berufung zum Dienst am und im Glauben seiner Religion in unserer (westlichen) Welt.
Wenn wir nun annehmen, das 21. Jahrhundert sei zu einer zweiten Vernunftaufklärung berufen, welche die des 18. Jahrhunderts beerben und überbieten könnte, müsste auch das Wesen einer "Künstlichen Intelligenz" auf dem Boden der Vernunft gesät und gehegt worden sein. Dem widerspricht bis heute das Faktum, dass der Mensch als körperlich natürlicher Mensch existieren muss, um als Träger seiner Intelligenz existieren zu können.
Und ob es ihm gelingen wird, diese Schranke seines natürlichen Wesens entweder durch einen lebenslangen Umgang mit digitalen Informationsmedien oder durch eine operative Einverleibung intelligenter Chips und neuronaler "Inputs" (oder auch auf beiden "bahnbrechenden" Wegen) hinter sich zu lassen, ist eine Frage, der sich die "neue Aufklärung" möglichst bald zuwenden sollte, um gewisse menschheitsgefährdende Entwicklungen "an Leib und Seele", wie Kant vermutlich formuliert hätte, zu vermeiden.
Leo Dorner ist ein österreichischer Philosoph.

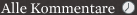
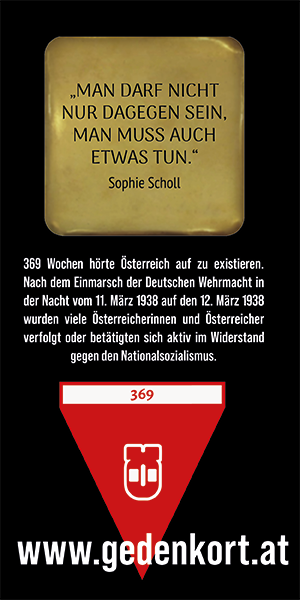
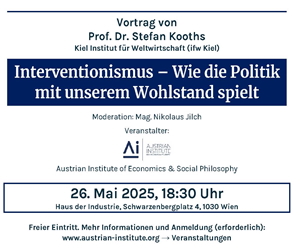



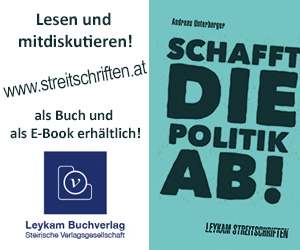
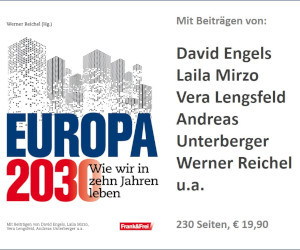

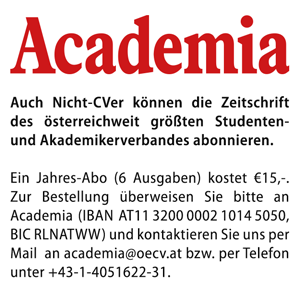

Kritisches Denken im Zeitalter der KI bedeutet, Kants Aufruf zum Selberdenken neu zu buchstabieren. „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ – dieser Satz klingt heute veraltet, in einer Welt, in der Chatbots und Algorithmen längst die Denkarbeit übernehmen. Doch genau hier beginnt die Prüfung: Wer KI nutzt, ohne sie und sich selbst zu prüfen, wird vom Werkzeug zum Werkstück. Kants Vernunftbegriff verlangt, das Urteil nicht an andere, z.B. Maschinen zu delegieren, sondern es an ihnen zu schärfen. KI liefert Daten, aber keine Kategorien; sie rechnet, doch sie denkt nicht. Der Mensch bleibt verantwortlich für das, was er glaubt, entscheidet und schafft. Vernunft, sagt Kant, ist „Gesetzgeber der Natur“ – sie lässt sich nicht von der Maschine entthronen. Kritisch denken heißt: die Grenze zwischen Erkenntnis und Bequemlichkeit zu bewachen, damit der Mensch Subjekt bleibt und nicht zum algorithmischen Objekt seiner eigenen Feigheit wird.
Genau erkannt, Chapeau. Aber folgt daraus nicht, daß wir eine neue, eine zweite, eine weitergeführte (differenzierte usf.) Vernunftauklärung benötigen?
Also gerade nicht die der selbsternannten, woken Dunkelmänner von Grün und LInks, sondern eine, die diese falsch Erleuchteten als Gegenaufklärer enttarnt? Möglicherweise hängt daran sogar das Überleben der westlichen Welt und Gesellschaft.
Ein schwieriges Unterfangen in einer Zeit, die mit "Idiocrazy" hinreichend charakterisiert ist. Es fehlt sowohl an einem Großmeister Immanuel Kant als auch an genügend Rezipienten, die auch nur annähernd begreifen würden, was er überhaupt meint.
Ich stimme zu: 2025 ist ein verrückter Zwilling des Jahres 1925.