Am 22. Mai forderten die konservative italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre dänische Amtskollegin, die Sozialdemokratin Mette Frederiksen, im Anschluss an ihre Beratungen in Rom dringend "eine neue und offene Diskussion über die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention" (EMRK). In einem Offenen Brief, der auch von den Ministerpräsidenten Belgiens, Estlands, Lettlands, Polens, Österreichs, der Tschechischen Republik sowie dem Präsidenten Litauens unterzeichnet wurde, kritisierten sie die extensive Auslegung der EMRK durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). "What was once right might not be the answer of tomorrow", heißt es in dem Brief. Es müsse untersucht werden, "whether the Court, in some cases, has extended the scope of the Convention too far as compared with the original intentions behind the Convention, thus shifting the balance between the interests which should be protected." Die Unterzeichner des Briefes wenden sich insbesondere gegen die Einschränkung der Befugnisse der Nationalstaaten, kriminelle Migranten abzuschieben, auch wenn sie schwerer Straftaten wie Gewaltverbrechen oder Drogenkriminalität für schuldig befunden worden sind.
Bereits auf dem EU-Gipfel am 17. Oktober hatten sich die 27 Staats- und Regierungschefs für "entschlossene Maßnahmen auf allen Ebenen zur Erleichterung und Beschleunigung der Rückführungen" ausgesprochen und die Kommission aufgefordert, so schnell wie möglich ein entsprechendes neues Gesetz vorzubereiten. Die erst im Frühjahr 2024 beschlossene EU-Asylreform trägt nach Ansicht vieler Mitgliedsstaaten wenig zur Lösung dieses Problems bei.
Der Brief aus Rom geht jedoch in einem wesentlichen Punkt weiter. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Gewichts der Gerichte bezieht er sich auf die seit Jahren schwelenden Konflikte zwischen Regierungen und Parlamenten auf der einen, nationalen und europäischen Gerichten auf der anderen Seite. Sie eskalieren regelmäßig, wenn die Aufteilung der Kompetenzen der Legislative, der Exekutive und der Judikative auf nationaler Ebene in Frage gestellt werden und/oder wenn nationale Gerichte politische Entscheidungen ihrer Regierungen unter Berufung auf europäisches Recht außer Kraft setzen.
Der bisher ungelöste Streit um das italienisch-albanische Migrationsabkommen ist ein besonders krasses Beispiel. Im November 2023 unterzeichneten die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der albanische Ministerpräsident Edi Rama ein auf fünf Jahre begrenztes Abkommen über die Einrichtung von zwei Aufnahmezentren in Shengjin und Gjader, die von Italien finanziert und geleitet werden sollten. In diesen beiden Zentren wollte die italienische Regierung einerseits die Asylberechtigung von im Mittelmeer geretteten Migranten in beschleunigten Verfahren überprüfen, andererseits Migranten konzentrieren, deren Asylantrag in Italien bereits abgelehnt worden ist und die von Albanien aus in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollen.
Das Abkommen hat seinen Zweck bis heute nicht erreicht, weil die italienische Justiz wiederholt die Überstellung der Migranten nach Albanien für rechtwidrig erklärte. Unter dem Beifall der linken Opposition und verschiedener Menschenrechtsorganisationen beriefen sich die Richter dabei auf einen Spruch des EuGH vom 4. Oktober 2024, demzufolge Migranten nur in Herkunftsländer abgeschoben werden dürfen, in denen die Sicherheit aller Personen auf dem gesamten Territorium gewährleistet ist. Diese Voraussetzungen seien in Ägypten, Bangladesch, Gambia, Elfenbeinküste und anderen Staaten nicht gegeben. Wenn ein Land nicht durchgehend als sicher gilt, dürfen Asylanträge von Personen aus diesem Land nicht automatisch im beschleunigten Verfahren abgelehnt oder die Personen in Drittstaaten wie Albanien interniert werden, ohne dass ihre individuelle Situation geprüft wird.
Die Beurteilung als "sicheres Herkunftsland" obliegt nach der Rechtsauffassung der italienischen Richter nicht der Regierung, sondern den Gerichten, die auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention zu entscheiden hätten.
Die Kosten, die Italien für die Errichtung und den Betrieb der beiden Zentren in Italien bisher entstanden sind, werden auf 650 bis 800 Millionen Euro geschätzt. Die Regierung in Rom hatte damit gerechnet, in Albanien jährlich an die 36.000 Asyl- und Abschiebeverfahren abwickeln zu können.
Der Konflikt landete vor dem EuGH, der Ausgang des Verfahrens wird mit Spannung erwartet. Die Richter werden wohl nicht umhin kommen, auch die Stimmung der Bürger in den Mitgliedsländern zu berücksichtigen. Nicht nur Italien, sondern auch andere Regierungen sind an einer Offshore-Bearbeitung von Asylanträgen interessiert. Entsprechende Vorschläge, die im Mai 2024 von 15 EU-Mitgliedsstaaten gefordert wurden, liegen im europäischen Trend und widerspiegeln den wachsenden Einfluss migrationskritischer Parteien.
In Dänemark ist seit 2021 ein Gesetz in Kraft, das die Überstellung von Asylsuchenden zur Bearbeitung in Drittstaaten ermöglicht. In Deutschland schlug der Migrationsbeauftragte der Regierung Scholz im September 2024 vor, Asylanträge in Ruanda zu bearbeiten, und Bundeskanzler Friedrich Merz plädierte jüngst für Abschiebungen nach Syrien, das wohl ebensowenig als "sicheres Herkunftsland" eingestuft werden dürfte wie Ägypten oder Bangladesch. Nach dem Sturz des Assad-Regime deportierte Österreich am 3. Juli als erstes Land in der EU einen syrischen Kriminellen in seine Heimat. In Griechenland stellen Richter die Rechtmäßigkeit von Zurückweisungen an den Grenzen in Frage und kritisieren die Bedingungen in den Auffanglagern für Migranten. In Polen wehrt sich die Regierung gegen heimische Gerichte und den EGMR, die verschärfte Kontrollen und Rückführungen an der Grenze zu Belarus beanstanden.
Andreas Khol, Verfassungsrechtler und ehemaliger Präsident des österreichischen Nationalrats (Parlaments), glaubt nicht, dass sich eine Lösung dieser Konflikte anbahnt: "Alle derzeit panisch gesuchten Wege der Union, der unter dem Vorwand der Asylsuche über Europa hereingebrochenen illegalen Einwanderung eine Ende zu bereiten, müssen so lange scheitern, als Art. 3 EMRK (und die korrespondierenden Bestimmungen der EU-Grundrechtscharta) sowie die Bestimmungen aus dem Amsterdamer Vertrag in Teil V des EU-Vertrags (Art. 67ff) unverändert gelten." Um die Macht der Richter einzuschränken, müssten sich also das Europäische Parlament und die 27 Mitgliedsstaaten auf eine Änderung des Amsterdamer Vertrags einigen, was äußerst unwahrscheinlich ist. Und nicht nur das: Einer Revision der Europäischen Menschenrechtskonvention müssten die 46 Staaten des Europarats zustimmen.
Man dürfe sich, mahnt der deutsche Rechtswissenschaftler Frank Schorkopf, "die begrenzenden und kontrollierenden Institutionen des modernen Verfassungsstaates nicht als oktroyiert, als extern gegeben vorstellen. Keines der genannten Merkmale ist anti-demokratisch. Sie werden in der Regel durch demokratisch verantwortete Selbstbindung zuerst in der Verfassung und sodann qua Gesetzgebung und Rechtsprechung verwirklicht. Auch die überstaatliche Bindung beruht immer noch auf dem zustimmenden Staatenwillen, selbst wenn dieser – gerade in der europäischen Integration ist das der Fall – nicht auf genaue Inhalte bezogen ist, sondern auf abstrakte Ziele, und zu umfangreicher Sekundärrechtsetzung ermächtigt."
Die Macht der Richter in der EU beruht nicht nur darauf, dass die "ever closer union among the peoples of Europe" in den EU-Verträgen verankert ist, was es dem EuGH ermöglicht, teleologisch vorzugehen, das heißt das EU-Recht im Sinne einer immer weiter gehenden Integration kreativ zu interpretieren, statt sich auf den Text der Verträge zu beschränken. In anderen Worten: Statt Recht anzuwenden, schaffen sie Recht.
Das eigentliche Dilemma besteht darin, dass der EuGH die europäischen Verträge mit den Wirkungen einer Verfassung versehen hat, wodurch er alles, was auf der Rechtsgrundlage der EU geregelt ist, dem demokratischen Prozess entzieht. Diese Verträge sind jedoch keine Verfassung, sie sind vielmehr voll von Bestimmungen, die in jedem Staat einfaches Gesetzesrecht wären. Die Folge ist, dass die Mitgliedstaaten immer wieder rechtlichen Vorschriften unterworfen werden, die sie im nationalen demokratischen Prozess abgelehnt haben. Dieses Dilemma ließe sich lösen, wenn man alle Bestimmungen der Verträge, die nichts mit Verfassung zu tun haben, so herabstufte, dass sie im demokratischen Prozess geändert werden könnten. Bis dahin laufen Vorschläge von der Art des Offenen Briefs Melonis und Frederiksens rechtlich ins Leere.
Anders als der EuGH kann der EGMR keine Sanktionen verhängen, weil er nicht über Exekutivbefugnisse verfügt. Ein spektakulärer Fall ist das EGMR-Urteil vom 9.April 2024. Die "KlimaSeniorinnen Schweiz" hatten ihr Land wegen angeblich unzureichender Klimaschutzmaßnahmen beim EGMR geklagt, nachdem Schweizer Gerichte ihre Klage in drei Instanzen abgewiesen hatten. Nach Ansicht des EGMR habe die Schweiz, die dem Europarat, aber nicht der EU angehört, dadurch gegen die Menschenrechte gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verstoßen.
Zum ersten Mal erklärte ein Gericht damit den Klimaschutz zu einem Menschenrecht, was weitere Klagen strategisch operierender NGOs nach sich ziehen dürfe. Das Schweizer Parlament hat das Urteil als "Gerichtsaktivismus" zurückgewiesen. EGMR-Urteile sind endgültig; die Schweiz ist verpflichtet, ihre Klimapolitik vor dem Ministerkomitee des Europarats zu rechtfertigen. Es ist zu erwarten, dass die "KlimaSeniorinnen" und ihre Verbündeten sich abermals beim EGMR beschweren werden, weil sie die entsprechenden Maßnahmen der Schweiz für nicht ausreichend erachten.
1835 hat Alexis de Tocqueville, bezogen auf die Vereinigten Staaten, die zunehmende Verrechtlichung der Politik vorausgesagt: "There is hardly any political question in the United States that sooner or later does not turn into a judicial question (…) the spirit of the jurist, born inside the schools and courtrooms, spreads little by little beyond their confines; it infiltrates all of society, so to speak; it descends to the lowest ranks, and the entire people finishes by acquiring a part of the habits and tastes of the magistrate." In den USA gibt es mittlerweile 383 Anwälte je 100.000 Einwohner, in Italien sind es sogar 401.
Die wachsende Macht der Judikative wurde seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem globalen Phänomen. In der Fachliteratur liest man von "legislators in robes”, einer "Judicial Era” und der Verwandlung der Demokratie in eine "juristocracy”. Rand Hirschl nennt drei Hauptaspekte dieses Trends: "(1) the dramatic increase in the number and types of national and transnational courts and tribunals; (2) the ever-growing significance of courts and judges in determining political and policy-making outcomes worldwide; and (3) criticism of, resistance to, and occasional backlash against expanded judicial power."
Diese Entwicklung habe mit den Demokratisierungsprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika begonnen und sich mit dem Ende der kommunistischen Regime beschleunigt. Damit verbunden sei ein "global constitutionalism”, der immer mehr Rechte in den Verfassungen verankert und internationale Normen festschreibt: "Anything from taxation, welfare, and public works to licensing, immigration, border control, and policing has been heavily juridified. The expansion of the regulatory state to encompass new frontiers such as consumer protection, telecommunication and information technology, banking, anti-trust, and mergers and acquisitions has provided added impetus for the expansion of judicial power. (…) Put bluntly, the ever-increasing demand for law, courts, and judges provides the judicial sphere, and the legal profession more generally, with a tremendous opportunity to increase its own influence."
Einem internationalen Vergleich zufolge schützten nationale Verfassungen heute im Schnitt 48 Rechte, so viele wie nie zuvor. Manche sind deklamatorisch, aber die meisten sind justiziabel. Parallel dazu wuchs die Richtergewalt auf der internationalen Ebene, wofür die Gerichte der EU und des Europarats die augenfälligsten, aber keineswegs die einzigen Beispiele sind. Zwischen 1985 und 2020 hat sich die Zahl der internationalen Gerichtshöfe mehr als verdreifacht.
Je mehr die Macht der Gerichte wächst, desto mehr versuchen politische Akteure, auf die Zusammensetzung und die Tätigkeit der Gerichte Einfluss zu nehmen. Daraus erwachsende Konflikte haben zum Beispiel in Ungarn, Polen und Israel zu Verfassungskrisen geführt.
Szenarien
1) Eine Revision der EU-Verträge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist äußerst unwahrscheinlich. Das daraus resultierende Dilemma bleibt bestehen.
2) Die zunehmende Macht der Gerichte untergräbt das Vertrauen in die Demokratien und führt zu einem weiteren Anwachsen populistischer Parteien und Bewegungen. In der Folge verschärfen sich die Konflikte zwischen den Regierungen der EU-Mitgliedsländer, die immer stärker unter den Druck ihrer Wähler geraten, sowie der EU-Kommission und den europäischen Gerichten, die in einem weitgehend geschützten Raum operieren.
3) Demokratisch nicht legitimierte Pressure groups gesellschaftlicher Minderheiten werden danach trachten, die Macht der mit ihnen sympathisierenden Richter gegen den Willen der Mehrheit der Wähler für ihre Anliegen zu instrumentalisieren. Die zentrifugalen Tendenzen in der EU werden zunehmen, falls es nicht gelingt, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Legislative, Exekutive und Judikative herzustellen.
Karl-Peter Schwarz ist Autor und Journalist; er war früher bei "Presse", ORF und FAZ tätig. Eine gekürzte englische Version dieses Textes ist auf GIS erschienen.

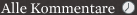
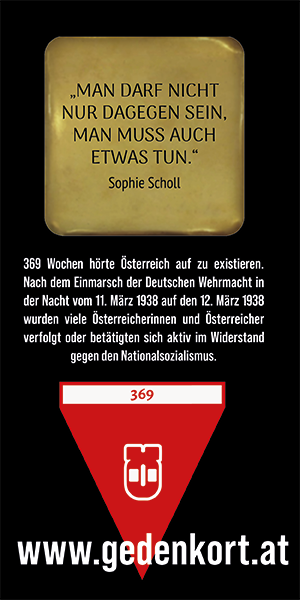
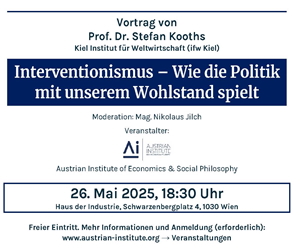



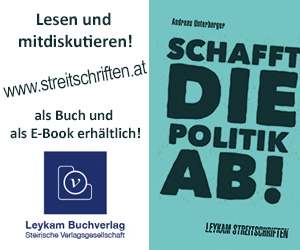
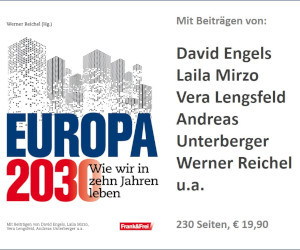

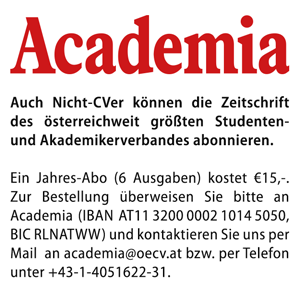

Die Wende hin zum außerparlamentarischen Richterstaat ist aktuell auch gut bei den anstehenden Besetzungen zum deutschen Verfassungsgerichtshof zu beobachten.
Herzlichen Dank für dieses Memorandum in Tocquevilles Geist von 1835.
Der Weg von der Demokratie zur Juristokratie scheint unumkehrbar und insofern „Schicksal“ zu sein. Sowohl in der EU, wie auch in ihren Mitgliedsstaaten, - ein „globaler „Prozeß“, der auch die Nichtmitgliedsstaaten (wie die Schweiz) nicht unberührt läßt. Und auch die „alten“ internationalen Institutionen wie UNO, WHO und deren Suborganisationen leiden oder „blühen“ unter dem Segen der weltweit vernetzten Juristokraten:
Diese agieren wie eine Religion mit Missionierungsauftrag und trachten aufsässigen Demokratien, wie beispielsweise Israel, nach dem Leben. Schon Merkel, zB. 1916 in Marrakesch, ließ ihr Gewissen (bei der Zerstörung Europas) unter diesen Schutzschirm, der mit dem Segen des Papstes alle Stimmen der rettenden Vernunft zum Verstummen brachte, “reinwaschen.“
Wohin dieses „Schicksal“ führt, ist am „gründlichsten“ (wieder einmal) im Deutschland von 2025 zu beobachten.
Die erstarkenden Kräfte des neuen linksgrünen Faschismus bedienen sich mit Vorliebe und Schläue aller „rechtsstaatlichen“ Mittel, um ihre Ideologie im Kielwasser voranfahrender NGOs und Kirchenvereine durchzusetzen. Und die Mehrheit des Untertanen-Michels schläft und schläft...
Merkels Europa-Harakiri wurde 2016, nicht 1916 verübt. Und auch Hitlers Harakiri mußte im Jahr 1916 noch abwarten. Die Mühlen es historischen Schickals mahlen langsam
Danke für ihre Expertise, die mögliche aber langwierig Reformen aufzeigt. Die Zeit haben wir einfach nicht mehr, es muss jetzt schneller gehen.
Ein EU-Austritt der Länder Slowakei, Ungarn und Österreich wäre eine Möglichkeit um dieses baufällige Konstrukt in Richtung Auflösung zu treiben. Eine Reform ist meiner Meinung nach unmöglich. Eine politisch-wirtschaftliche Neuausrichtung, eventuell zusammen mit Serbien könnte einen wirksamer Gegenpol bilden.
Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hält eine EU-Mitgliedschaft seines Landes im Jahr 2028 für unwahrscheinlich. Dieser Termin wird von einigen anderen Westbalkan-Staaten, die wie Serbien in die Gemeinschaft streben, angepeilt. Ein milliardenschwerer Rüstungsdeal aber deutet einen Wandel in Serbiens Außenpolitik an.
Mein Vertrauen in den Rechtsstaat und Demokratie ist nicht mehr vorhandenen. Wenn man eine Änderung der Gesetzeslage und Konventionen gewollt hätte, hätte man dazu schon einen Weg gefunden. Aber man wollte nicht. Der Wähler wendet sich jenen Parteien zu, die seine Interessen vertreten, da braucht man diese nicht als populistisch beschimpfen, denn das könnte, nein sollte, jede Partei tun.