Auf 271 Seiten versucht Markus Gabriel – mit Jahrgang 1980 der wohl jüngste Philosophieprofessor Deutschlands – zu begründen, „warum es die Welt nicht gibt". Seine wort- und einfallsreichen Begründungen lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Es gibt die Welt nicht, weil es Gott nicht gibt. Gott existiert nicht „in dem Sinne, dass es eine Person gibt, die Gesetze verhängt oder sich außerhalb des Universums an einem unzugänglichen Ort befindet" (S. 208).
Gott ist „kein Prinzip, das alles zusammenhält und organisiert. Die Welt gibt es nicht. Auch Gott kann es demnach nicht geben, wenn wir unter <Gott> ein solches Prinzip verstehen" (S.211).
„Man könnte provokativ sogar sagen, dass Religion die Einsicht ist, dass es Gott nicht gibt, dass Gott kein Objekt oder Supergegenstand ist, der den Sinn unseres Lebens garantiert" (S. 211). „Wenn man meint, dass es einen großen Regenten gibt, der das Universum und das menschliche Leben steuert, täuscht man sich. Denn es gibt kein solches Weltganzes, das dann auch noch jemand zu regieren hätte" (S. 212). Religion als „Vorstellung von einem allumfassenden, alles beherrschenden Weltprinzip" ist „Fetischismus" (S. 185). „Der Fetischismus identifiziert ein Objekt als den Ursprung von allem und versucht, aus diesem Objekt die Identitätsmuster zu entwickeln, denen alle Menschen Folge leisten sollten. Dabei spielt es dann nur noch an der Oberfläche eine Rolle, ob Gott oder der Big Bang verehrt wird" (S. 190).
Gabriels Auffassung hat politische Konsequenzen: Wenn es Gott und die Welt nicht gibt, „dann gibt es auch keine einheitliche deutsche Gesellschaft, in die man dann irgendjemand integrieren müsste" (S. 236). Demokratie steht „dem Totalitarismus entgegen, weil sie in der Anerkennung der Tatsache besteht, dass es keine abschließende, alles umfassende Wahrheit" gibt (S. 236). Weil die eine Welt nicht existiert, „existieren viele Sinnfelder" und Perspektiven (vgl. S. 240). „Die Vielzahl real existierender Perspektiven anzuerkennen ist gerade die Pointe moderner Freiheit (…), die nicht auf eine unnötige Vereinheitlichung setzt" (S. 254). Politik ist gefordert, sich dem „Perspektivenmanagement" zu stellen (S. 236).
Markus Gabriel nennt seine Anschauungen „Neuen Realismus". In ihm spiegelt sich die heute allgegenwärtige „Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt" (J. Ratzinger, 2005). Nichts gegen Philosophen, welche sich dieser Diktatur unterwerfen und, gestützt auf Film- und Fernsehserien, eine Art Show about Nothing abziehen. Doch zum akademischen Comment gehört es, sich mit der wichtigsten Gegenstimme auseinanderzusetzen, die sich dieser Diktatur des Relativismus widersetzt. Das ist heute wie seit eh und je das Lehramt der katholischen Kirche, dessen Äußerungen zu philosophischen Grundfragen höchste Beachtung verdienen.
Zum einen kommt in diesen Äußerungen nicht eine persönliche Meinung, sondern eine kollektive Stimme zum Ausdruck, die für über eine Milliarde Menschen spricht, ihnen Handlungsnormen und Werte vorgibt, und schon deswegen in der Öffentlichkeit ein weites Echo findet. Zum anderen sind lehramtliche Äußerungen häufig das Ergebnis intensiver Beratungen, an denen die feinsten Geister teilgenommen haben. Dadurch erhalten diese Äußerungen eine natürliche Autorität, die auf Argumentation und geistiger Gültigkeit beruht.
Solche autoritativen, kollektiven Äußerungen stellen häufig genug „Zeitgeistsperren” dar. Sie zu unterschlagen beruht entweder auf Ignoranz, oder meist auf dem Vorsatz, dem Lumen gentium keinen Platz einzuräumen und einer Auseinandersetzung mit diesem „Licht der Völker” aus dem Wege zu gehen. Für Markus Gabriel ist das typisch.
Im Quellenregister finden sich zwar zeitgenössische Regisseure wie Christoph Schliengensief oder Jean-Claude Brisseau, nicht jedoch philosophische Denker vom Rang eines Joseph Ratzinger oder Karol Wojtyla. Eine Auseinandersetzung mit so beutenden Enzykliken und Lehrdokumenten aus jüngster Zeit wie jenen über das Verhältnis von Glaube und Vernunft (Fides et ratio, 1998), von Wahrheit, Freiheit und Moral (Veritatis splendor, 1993), der Religionen zueinander (Nostra aetate, 1965), von Kirche und Welt (Gaudium et spes, 1965), von Kirche, Naturrecht und Demokratie (Evangelium vitae, 1995) oder über die Würde des Menschen (Dignitatis humanae, 1965) oder über die Soziale Frage (heute zusammengefasst im „Kompendium der Soziallehre der Kirche”, 2004), sucht man bei Gabriel vergebens.
Obwohl er die gleichen Themen in extenso behandelt, verzichtet er auf die Heranziehung dieser Weltdokumente. Philosophisch bewegen sich diese Dokumente auch auf der Ebene der „natürlichen Vernunft” und nicht nur der Theologie. Sie als die entschiedene und starke philosophische Gegenstimme gegen Relativismus und Modernismus nicht zu berücksichtigen, verkitscht den „Neuen Realismus” Gabiels zu einer primitiven Rechtfertigungs- und Beschwichtigungsphilosophie zum Zwecke der politisch korrekten Affirmation einer uns vorgespiegelten „heilen” Welt, welche die Sinn- und Wahrheitsfrage nicht mehr stellt und in einem wohlfeilen Gebräu aus Toleranz und Pluralismus ertränkt.
Cui bono? Der Unisono-Beifall aus der Ecke der gelenkten Qualitätsmedien (NZZ, FAZ, Spiegel, Süddeutsche, Welt, TV) legt die Antwort nahe.
Der Autor lehrte Politische Ökonomie in Wien, Graz und Aachen. Er veröffentlichte zuletzt „Die Rechte der Nation“ (Stocker, Graz 2002), „Der Sinn der Geschichte“ (Regin-Verlag, Kiel 2011) und „ESM-Verfassungsputsch in Europa“ (Schnellroda 2012).
Markus Gabriel: Warum es die Welt nicht gibt. 271 Seiten. 5. Aufl. Ullstein-Verlag, Berlin 2013. ISBN 978-3-550-0810-4. 18,00 €


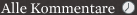
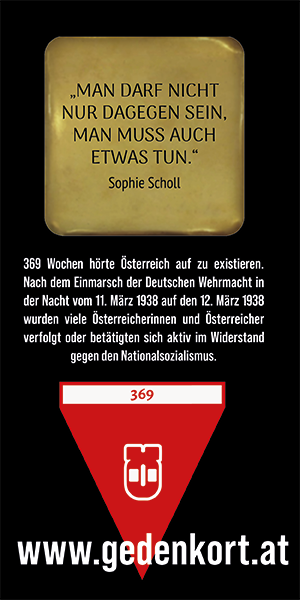
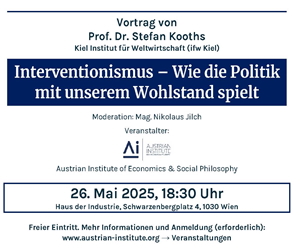



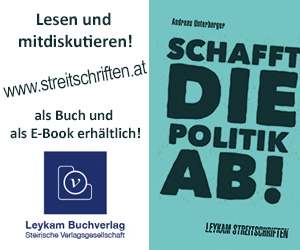
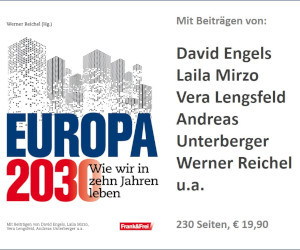

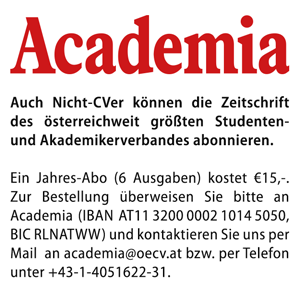

Die Zerstörung christlicher Werte und Traditionen ist zu einem System geworden.
Viele Journalisten, Politiker und sogenannte Wissenschaftler arbeiten eifrig daran.
Herr Gabriel ist einer von vielen, die mit diesem Machwerk und seinen krausen Theorien dazu beitragen!
Danke Friedrich Romig, ich habe dieses Elaborat schon vergessen!
"Es gibt die Welt nicht, weil es Gott nicht gibt."
Dann gibt es auch keinen Professor Markus Gabriel. Uns ebenfalls nicht!
Und daher können wir seinen Unsinn auch nicht lesen, schon gar nicht uns darüber Gedanken machen.
Soren Kierkegaard erklärte den Unterschied zwischen einer Kartoffel und dem Menschen, daß zwar beide Lebewesen seien, die Kartoffel aber nicht in Kontakt zu anderen Kartoffel treten kann, während wir Menschen sehr wohl zu anderen Menschen Beziehungen unterhalten.
Möge sich der Herr Markus Gabriel als Kartoffel fühlen, ich fühle mich als Mensch.
Und um es noch einmal mit Kierkegaard zu sagen, der Mensch hat sein höchstes Daseinsziel erreicht, wenn er sich Gott direkt und unmittelbar am nächsten fühlt, die Kartoffel kann das nicht!
Die Lage ist wirklich ernst, wenn derartige Ansichten mit dem Weihrauch akademisch-philosophischer „Autorität“ verkündet werden. Und Dr. Romig zeigt auch überdeutlich in welchem zeitgeistigen „Denken“ dies eingebettet ist, indem er den Beifall der üblichen „Qualitätsmedien“ erwähnt.
Dazu paßt, daß vor wenigen Tagen folgende Erklärung auf den Tisch flatterte:
The Roman Catholic Church is Declared a Transnational Criminal Organization
Itccs.org – International Tribunal into Crimes of Church and State, August 03, 2013
The Brussels Proclamation of August 4, 2013
A Legal Notice and Instrument issued by The International Common Law Court of Justice
…. (4 Seiten)
George Dufort, LL.B., Secretary of the Court
4 August, 2013
ICLCJ – 04/08/13
Betrachtet man dann auch noch den Zustand zahlreicher Vertreter des Klerus, dann ist man an Solowjows “Drei kleine Erzählungen“ – und hier an jene vom Antichrist – erinnert.
Seit Jahr und Tag bietet etwa das Stift Kremsmünster, eines der ältesten des Landes, in den sogenannten ökumenischen Sommergesprächen vor allem Atheisten und sonstigen Feinden von Religion und Kirche ein Podium; die Dummheit kennt offenbar keine Grnzen.
Zu Schönborn oder Schüller fällt mir schon nichts mehr ein.
Herrn Dr. Romig ist nur zu danken, daß er wortgewaltig und mit unerbittlicher Schärfe seiner Argumentation einen Pseudo-Philosophen als das demaskiert was er ist: ein angepaßter Schwätzer im Dienste des Zeitgeistes.
In Deutschland mangelt es nicht an angepassten Speichelleckern, um wieder einmal eine Diktatur errichten zu können.
Gabriel kritisiert hier, unbewußt, den jüdischen und den mohammedanischen, jenseitigen, monotheistischen Gott, nicht den christlichen. Von der Trinität hat er offenbar keinen Begriff. Der trinitarische Gott ist kein Monokrat, er zwingt nicht, er überführt, er ist kein jenseitiger Gott, er ist in Jesus Christus Mensch geworden und hat so die menschliche Natur wieder in das göttliche Leben aufgenommen und er ist kein jenseitiges Gespenst, sondern gegenwärtig als Geist.
Die Trinität ist die Festung des Glaubens, an der all diese oberflächliche Kritik abprallt. Seit der Ablösung der Heilsmission des jüdischen Volkes durch Jesus Christus und der von Paulus betriebenen Heidenmission konkurrierten viele Völker dieser Erde um die wahre Nachfolge Christi. Jedes Volk ist so ein Schöpfungsgedanke Gottes und Zeichen der Gegenwart Gottes in der Welt. Das Konzept der multikriminellen Gesellschaft ist so widergöttlich, wie etwas nur widergöttlich sein kann.
Das deutsche Volk ist ein ganz herausragendes Beispiel christlicher Kultur und Mission. Die Theologie der Kirche ist überragend deutschen Ursprungs und fünfzig Prozent des finanziellen Aufwandes der Weltkirche wird heute noch von Deutschland getragen. Man könnte meinen, dass Deutschland eine ganz hervorragende Rolle in der Endzeit auszuführen hat, weswegen diese Mitte Europas geistig ganz besonders umkämpt ist, wobei die Deutschen sich offenbar durch die Preisgabe ihrer Nation wieder in der selben Sonderrolle befinden, die sie innehatten, als sie ihre Nation überhöhten.
Jede (einstige) christliche Kulturnation dieser Welt, nicht nur Deutschland ist dermaßen bestückt mit geistigen Zeugnissen des Glaubens, dass man wirklich mit dem Prediger des AT sagen kann: Nur der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott!
Und Torheit ist auf akademischen Lehrstühlen, weiß Gott, keine Seltenheit.
Den Menschen von Gott zu trennen gelingt nur, wenn man ihn verblödet und gutmenschlich terrorisiert - aber auch das bestimmt nicht für lange Zeit!
Und Torheit ist auf akademischen Lehrstühlen, weiß Gott, keine Seltenheit.
Die akademische Philosophie im deutschen Sprachraum ist - wie man an diesem Beispiel unschwer erkennt - in einem komatösen Zustand. Es ist atemberaubend, mit welchem kranken Geschwätz man zum Lehrstuhlinhaber werden kann.
Der junge Herr Professor sollte einmal - rein historisch - erforschen, welche Institution das Überleben der antiken Philosophie und deren Entfaltung überhaupt erst möglich gemacht hat: Das war ausschließlich die Katholische Kirche (bzw. die Kirche von Byzanz vor und nach der Trennung), die in Klöstern und Domschulen Platon und Aristoteles bewahrt haben.
Es ist ausschließlich das rechtgläubige Christentum, in dem sich das Denken entfalten kann und entfaltet hat. Der Unglaube führt auch immer in die Irrationalität, bzw. in den Wahnsinn und in weiterer Folge in den Totalitarismus.
Dem geschätzten Herr Dozenten Romig ist allerdings leider auch ein kleiner Fehler unterlaufen: Er hat übersehen, daß die weitschweifigen, unklaren und antinomischen Texte des II. Vaticanums (hier Gaudium et Spes, Nostra Aetate und Dignitatis Humanae genannt) evidenterweise nicht in einer Kontinuität zum alten, kristallklaren, philosophisch profunden Lehramt stehen bzw. stehen wollen.
Im Gegenteil hat sich am Konzil eine geradezu gespenstische Renaissance der Irrationalität, ja der Gnosis ereignet. Insofern hätte Doz. Romig auf eine positive Nennung dieser Texte verzichten sollen, weil sie gerade seine eigene Aussageabsicht, wie sie sonst im Text zum Ausdruck kommt, untergraben.